Brüssel
Die Europäische Kommission tagt in einer Reihe von Zweckbauten am Rand der Ringbahn-Auffahrt von Beaulieu. Dort gibt es auch einen kleinen Teich, an dessen Rand ein Junge mit dem Stock in der Hand gegen ein Schwanenpaar kämpft, das sein Junges zischend verteidigt. Etwas weiter auf dem Lac haben sich die Kanuten Tore aufgestellt, und ein einsamer Angler mit einem elektrischen Zappelfisch schmeißt lustlos seinen Köder ins trübe Wasser.
Der Belgier ist ein stoischer Erdulder. Man kann nach den Staus auf den Autobahnen in die europäische Hauptstadt hinein Uhren stellen. In jedem zweiten Auto sitzt ein Berufstätiger, der eine gute halbe Stunde für ruhenden Verkehr einplant. Manch einer liest Zeitung.
Beaulieu hat eine U-Bahn, das macht die Sache einfacher. Man steigt in den Zug und ist im Handumdrehen am Gare Centrale. Die Bahnhof allerdings bemerkt man nicht, denn sie ist im Untergrund. Heraus aus dem Schatten, herein ins Licht, und gleich die

Orientierung verloren.
Man merkt, der Autor war zum ersten Mal in Belgiens Metropole. In Begleitung eines Gutachters für die CE, dem das Schicksal aufgebürdet ist, im Zerrfeld von Umweltschutz und Autolobby um die Welt zu reisen wie Miles-and-More-George-Cloony und die schönsten Orte der Welt hauptsächlich aus dem Inneren von Asbestpalästen zu betrachten. Oder durch den Monitor seines Laptops während einer heimischen Videokonferenz. Das Weltkulturerbe ist für diese Personengruppe eher Rahmenprogramm.
Der Schönheit Brüssels nun misstraut der Neuankömmling beim Ausstieg aus der Metro allerdings erheblich. Nichts als Autos, die sich wie Mistkäfer durch eine riesige Baustelle wühlen.

Der erste Eindruck täuscht. Das ist gut für Belgien und für Europa. Und gut für den Besucher, der ein offenes Auge für die von Betonklötzen erdrückten Jugendstilhäuschen hat. Das war eigentlich das erste Ziel meiner Reise. Jugendstil lässt mir regelmäßig das Herz aufgehen. Der Eindruck, dass Mensch-Sein als Qualität begriffen werden kann – im Gegensatz zum Funktionellen einer in Zweckmäßigkeit erstarrten Mobilitätswüste – LEBT im Jugendstil. Die Häuser wirken, als wären sie erst nach dem Asbestangriff entstanden und dienten als Reflex der Moderne auf die Verkommenheit des bloß Nützlichen rundum.
Was mir zunächst widerfährt, ist ein orientierungsloser Gang durch die Straßenschluchten, der exakt – aber sowas von – vor dem komfortabelsten der je gesehenen Zigarrenläden endet. Ein Humidor von der Grundfläche zweier Garagen beherbergt alles. Punktum. Außer den Sumatras, schon gar nicht Panetelas, denn der Humidor ist karibisch. Zwei Zigarren landen in meiner Tasche und einige neue Brocken Französisch in meinem dürftigen Wortschatz. Und am Ende des Gesprächs mit einer hübschen Blonden weiß ich, was alle wissen wollen, nämlich den Weg zur Grande Place. Dahin mache ich mich auf.
Ich hatte ja immer schon ein Faible für den Waidmann St. Hubertus. Die Wallonen auch. Sie haben ihm eine überdachte Passage gewidmet, in der man zwar nicht rauchen, dafür aber mit Blick auf alle anderen Touristen in herrlichem Ambiente Kaffee trinken kann. Kaffee ist der zweite Schlag ins Gesicht des Brüssel-Reisenden. Goethe hätte gesagt, man kann ihn trinken. Ich meine, eher nicht. Drei von den Bechern kamen mir über die Zunge, in chronologischer Reihenfolge: an der Tankstelle (Wechselgeld für die U-Bahn, an der man nicht mit Scheinen zahlen kann) – reden wir nicht drüber (das Wechselgeld immerhin war echt)!
Dann der Kaffee am Platz, aber das ist ein eigenes Kapitel, zum Schluss dann noch einer in der Hubertuspassage. Bestellt: Café Latte, geliefert: ein Hybrid aus Wiener Melange und Senseo mit Kondensmilch, angerichtet mit herzförmigem Gebäck. Die belgische Waffel, die man sich irgendwann einmal gönnt, läuft hier aus der Konkurrenz. An Unterzuckerung wird kein Belgier sterben. Für Naschwerker ist Brüssel sicher ein Paradies. Ich bin noch auf dem Weg zur ersten Zigarre und damit zum ersten ernstzunehmenden Kaffee.
Als ich am großen Platz zwischen Häagen Dazs und Starbucks wählen muss oder der original spanischen Bodega, fällt mir ein simples Bar-Restaurant-Bistro-Café auf, dessen Style belgisch und deren Kellner zünftig wirken. Ich frage also einen nach dem Blick in die Karte erst, ob man rauchen darf und dann nach dem passenden Namen für einen französischen Grand Creme. Er sagt, das sei einfach nur Kaffee und bringt mir einen solchen. Es IST einfach nur Kaffee, aber cremig wie Maschinensoße, dazu unüblicherweise gleich zwei Töpfchen mit Kondensmilch. Der Spekulatius in Plastikhülle deutet den Ort des Geschehens an. Für all das entschädigt allerdings der Blick.
Hauptsächlich auf Japaner, Spanier und Chinesen. Deutsche sind unterrepräsentiert, wie ich finde. Und die Amerikaner scheinen auch zur Zeit alle im Sturbucks verschwunden.

Wenn man den Belgier sucht, geht man am besten ins Stadtmuseum. Das glotzt hinter prächtiger Fassade das Rathaus an und beherbergt die gesamte Stadtgeschichte. Erstmals begreift man dort, weshalb Brüssel ist, was es ist. Die Kolonialgeschichte Belgiens wird aktuell nicht mehr gern thematisiert. Daher wird man auch nicht begreifen, weshalb der schnuckelige Ort just zur Zeit vor der damaligen Jahrhundertwende einfach explodiert ist.
Das Stadtmuseum zeigt den Vorgang und hält in geradezu charmanter Belgizität noch ein Schmankerl parat für seine Besucher. Im obersten Stock der ehrwürdigen Gebäude läuft die Manneken-Pis-Ausstellung. Man sieht das Männchen aus Uniformen, Livreen, Arztkitteln pinkeln, Elvis und der Papst pinkeln aus den Vitrinen, Mohren, Dragoner, Chinesen. Eine Hommage an die Schneider und Kostümbildner und möglicherweise, aber da habe ich nicht genau hingeguckt, auch eine gefährliche Mohammedparodie darunter.

Nein, sicher nicht. Der Belgier jedenfalls nimmt sich selbst nicht so ernst, wie man auf den ersten Blick meinen sollte, und das macht ihn sofort sympathisch. Unten übrigens wird der Besucher empfangen von einer Ausstellung des Mord- und Totschlags der biblischen Geschichte, Kain und Abel, Stephanus und Drachentöters Michael. Auch das gehört zur Historie. Ein Hauch von Kongo biblisch verbrämt.
Eigentlich will ich auf Magritte zu sprechen kommen. Aber als Teil des Ganzen ist die Ausstellung kaum zu verstehen, wenn man einfach nur hingeht. Ohne vorher den Rest der Umgebung gesehen zu haben. Es ist nämlich so, dass man Magritte im Museum chronologisch angelegt hat. Das entwickelt sich ein wenig parallel zur stadtgeschichtlichen Exposition und auch zur Stadtgeschichte selbst. Man sieht und ahnt, aber entdeckt nur schwer die Linie. Magritte war unter anderem als Redakteur und Werbegrafiker tätig. Der Technik sieht man es gleich an. Ein technisch versierter Besucher wird Entwicklungslinien erkennen und Magrittes Werk betrachten lernen wie ein Klempner den Eiffelturm, wenn er seine Nieten bei einer Aufzugsfahrt von innen anschaut.
Interessant war am Aufbau des Magrittemuseums, dass die Kuratoren sich offenbar Mühe gegeben hatten, den Blick vom vielleicht wesentlichsten Ereignis in Magrittes Leben abzuwenden: dem frühen Tod der Mutter, die sich mutmaßlich ertränkte. Magritte war vierzehn. Seine Auslassungsfiguren zeigen ein bleibendes Trauma. Der surreale Eindruck einer Frau ohne Gesicht (die Mutter hatte beim Auffinden ihr Nachthemd um das Gesicht geschlungen) findet sich wieder und wieder. Die Bedrohlichkeit eines in seinen Gesetzen grundlegend erschütterten Universums schimmert aus jedem Bild. Und dennoch dieser monumentale kindliche Humor des Be-hüteten. Das alles wirkt sicher einseitig, wenn man es thematisiert, oder es war den Kuratoren zu abgedroschen. Sie haben ganz auf die Zeitlinie gesetzt, einen möglichst vollständigen Längsschnitt produziert und damit auch ein wenig Orientierungslosigkeit bewirkt.
Magritte, kurzum, trifft meine Stimmung sehr genau an diesem Tag. Und die Ausstellung bewegt noch einmal zum Nachdenken über Kunstpädagogik. Magritte kam nie weit aus seinem Heim heraus. Deshalb wird sein Hauptwerk auch im Heimatort Jette verwahrt. Brüssel ist nur eine Dependance wie Straßburg für Europa. Es lohnt sich trotzdem. Und vom Museumshügel hat man den besten Blick über den Rest der Metropole. Man könnte dort sogar Kaffee trinken. Weltenbummler sind Leute, die ihre Zeit in der Welt verbummeln. Oder ihre Welt in der Zeit. Am Abend starten wir den Heimweg – wie jeder gute Belgier – im Berufsverkehr. Was sagt das Navi?
Fahren Sie geradeaus, dann fahren Sie geradeaus ...
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
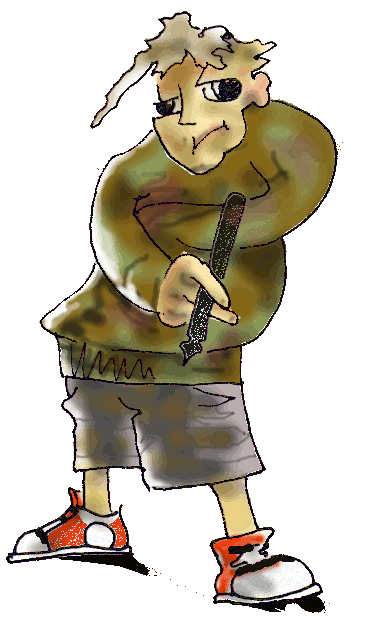
 Orientierung verloren.
Orientierung verloren.
 Der erste Eindruck täuscht. Das ist gut für Belgien und für Europa. Und gut für den Besucher, der ein offenes Auge für die von Betonklötzen erdrückten Jugendstilhäuschen Jugendstil in Brüsselhat. Das war eigentlich das erste Ziel meiner Reise. Jugendstil lässt mir regelmäßig das Herz aufgehen. Der Eindruck, dass Mensch-Sein als Qualität begriffen werden kann – im Gegensatz zum Funktionellen einer in Zweckmäßigkeit erstarrten Mobilitätswüste – LEBT im Jugendstil. Die Häuser wirken, als wären sie erst nach dem Asbestangriff entstanden und dienten als Reflex der Moderne auf die Verkommenheit des bloß Nützlichen rundum.
Der erste Eindruck täuscht. Das ist gut für Belgien und für Europa. Und gut für den Besucher, der ein offenes Auge für die von Betonklötzen erdrückten Jugendstilhäuschen Jugendstil in Brüsselhat. Das war eigentlich das erste Ziel meiner Reise. Jugendstil lässt mir regelmäßig das Herz aufgehen. Der Eindruck, dass Mensch-Sein als Qualität begriffen werden kann – im Gegensatz zum Funktionellen einer in Zweckmäßigkeit erstarrten Mobilitätswüste – LEBT im Jugendstil. Die Häuser wirken, als wären sie erst nach dem Asbestangriff entstanden und dienten als Reflex der Moderne auf die Verkommenheit des bloß Nützlichen rundum.
 Wenn man den Belgier sucht, geht man am besten ins Stadtmuseum. Das glotzt hinter prächtiger Fassade das Rathaus an und beherbergt die gesamte Stadtgeschichte. Erstmals begreift man dort, weshalb Brüssel ist, was es ist. Die Kolonialgeschichte Belgiens wird aktuell nicht mehr gern thematisiert. Daher wird man auch nicht begreifen, weshalb der schnuckelige Ort just zur Zeit vor der damaligen Jahrhundertwende einfach explodiert ist.
Wenn man den Belgier sucht, geht man am besten ins Stadtmuseum. Das glotzt hinter prächtiger Fassade das Rathaus an und beherbergt die gesamte Stadtgeschichte. Erstmals begreift man dort, weshalb Brüssel ist, was es ist. Die Kolonialgeschichte Belgiens wird aktuell nicht mehr gern thematisiert. Daher wird man auch nicht begreifen, weshalb der schnuckelige Ort just zur Zeit vor der damaligen Jahrhundertwende einfach explodiert ist.
 Nein, sicher nicht. Der Belgier jedenfalls nimmt sich selbst nicht so ernst, wie man auf den ersten Blick meinen sollte, und das macht ihn sofort sympathisch. Unten übrigens wird der Besucher empfangen von einer Ausstellung des Mord- und Totschlags der biblischen Geschichte, Kain und Abel, Stephanus und Drachentöters Michael. Auch das gehört zur Historie. Ein Hauch von Kongo biblisch verbrämt.
Nein, sicher nicht. Der Belgier jedenfalls nimmt sich selbst nicht so ernst, wie man auf den ersten Blick meinen sollte, und das macht ihn sofort sympathisch. Unten übrigens wird der Besucher empfangen von einer Ausstellung des Mord- und Totschlags der biblischen Geschichte, Kain und Abel, Stephanus und Drachentöters Michael. Auch das gehört zur Historie. Ein Hauch von Kongo biblisch verbrämt.