Die Cernadilla-Erfahrung

Leider bleibt das so. Morgens in der spartanischen Unterkunft aufgewacht, mache ich mich gleich zu einem Frühstück auf. Der erste Ort, Olleros de Tera, ausgestorben, ich nehme den Umweg über Vega de Tera. Nach einer Stunde erreiche ich den kleinen Ort, ausgestorben. Sehe die Landstraße entlang und glaube, in der Ferne eine weitere Ortschaft auszumachen, in der es vielleicht Frühstück geben kann, ein Café, die rettende Bar. Mattigkeit holt mich ein, als ich den Ort selbst erreiche und dort wieder kein Café finde. Junquera de Tera liegt langgezogen an der Carretera N-525. Am Ende der Ortschaft parken Autos, Kommen und Gehen von Menschen zeigt mir vermeintlich an, dass ich dort suchen muss. Mittlerweile ist es nach neun und die Kilometer werden mir schwer.

Ich spüre, dass ich nicht gehe, vielmehr laufe. Endlich zum Frühstück. Es macht keinen Spaß, und ich muss mir Gedanken über mein Verhalten insgesamt machen. Ich fühle mich auf der Flucht, seit die Gruppe der Sportler aus Tábara mir im Nacken sitzt. Aber will ich meine Reise abhängig machen von einem Wettkampf? Rennt mir wegen meines Engagements als Reiseleiter im September die Zeit zur Vorbereitung davon? Kann ich mich von diesem Streß befreien, oder werde ich jetzt nach Santiago laufen wie ein Rennpferd? Wo ist die Entdeckerlust? Wo sind die ruhigen Stunden, in denen man in einer Dorfschänke seine Blasen pflegt? Gespräche? Die schöne, ruhige Zeit des Camino, wo ist sie hin?
Am Dorfausgang entdecke ich die nächste Fehleinschätzung. Die Autos parken vor einer Werkstatt. Dort herrscht Kommen und Gehen. Kaffee gibt es nicht. Ich frage einen Señor, der dort neben seinem Auto steht, nach dem nächsten Café. „Am Ortseingang“, antwortet er, und deutet in die Ferne, aus der ich gerade komme, „einen Kilometer vielleicht, vielleicht auch mehr.“ Freunde schicken mir Nachrichten aufs Handy, ich solle nicht zu dick werden. Gut, ihr Wunsch ist erfüllt. Da fragt mich der Señor, woher ich denn käme. Deutschland. „Ah“, meint er, und wechselt ins Deutsche, „zwölf Jahre Deutschland.“ Er hat dort als Schweißer gearbeitet. Fragt nach Angela Merkel. Ich frage ihn, wann er denn zurück gekehrt sei. Vor fünfundvierzig Jahren, antwortet er. Ich blicke ihm ins Gesicht, hinters Ohr, die Statur rauf und runter, und denke an ein Missverständnis. Nein, der Mann ist 86 Jahre alt. Ich kann es nicht glauben. Er hätte auch 186 sagen können, es klingt gleich unwahrscheinlich. Ist aber wahr. Jetzt, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, blickt er vorwärts und zurück und fragt, ob ich auf dem Camino wäre und von wo gestartet. Sevilla? Tatsächlich. Na, dann wäre es ja falsch, zum Ortseingang zurück zu laufen und dann die Strecke noch einmal. Ich solle gleich nach Rionegro gehen, da sei ein Café, es liege in meiner Richtung. Ein paar Kilometer noch, aber es liegt auf meinem Weg.
Wir verabschieden uns freundlich mit dem Buen Camino, den ich an diesem Tag zum ersten Mal höre und so herzlich auch schon vermisse. Dann laufe ich weiter dem Frühstück entgegen. Und laufe und laufe und kann doch die Kartenmap nicht überlisten. Als Rionegro endlich in Sicht kommt, bin ich ausgelaugt, als hätte ich meine Tagesetappe schon hinter mir. Tatsächlich. Ein Blick auf die Karte zeigt mir, dass ich für den Tag schon genug gelaufen bin. Es ist halb elf. Ein Café hat endlich geöffnet. Der Bäcker allerdings war noch nicht da. Zum Frühstück gibt es eine Madalena aus dem Plastikbeutel. Dann weiter und weiter und weiter. In Mombuey endlich die ersehnten Bars. Ich suche mir eine nette Bar in der Dorfmitte und gehe hinein, frage nach dem Menü und - ja - die Kellnerin rennt kopfschüttelnd zu ihrem Kollegen, kommt wieder herein und wirft im Vorbeigehen hin: „Va mierda, no tengo mesa.“ Dazu fällt mir nun nichts mehr ein. Offenbar streiten die beiden, wer Einzelgäste bewirten soll, und werden sich nicht einig. Dem Ärger ausweichend, verlasse ich die Bar und gehe zur nächsten, entdecke dann am Ortsrand was hübsches und als ich dort vor der Terrasse stehe, ist das Lokal geschlossen. Ich gehe also eins weiter und weiter und lande zwei Kilometer von der Kirche entfernt vor dem Ortsschild. Umkehren? Ins Kernland der Gastfreundschaft?

Die nächsten Ortschaften, die da kommen, sind eine wie die andere ausgestorben, haben keine Cafés und keine Bars und keine Herbergen. Jetzt begreife ich, weshalb man in Mombuey so wenig freundlich mit den Gästen umgehen kann. Es liegt an einem Stausee, der Ort ist voller Feriengäste, viele französische Klänge hört man auf der Straße, es ist schnelles Geld im Spiel und die Peregrinos, naja, nehmen vielleicht nur den Platz weg. Rundum Niemandsland, also kann man nicht anders als in Mombuey einkehren. Ich bin schon eine Stunde weg, als mir und meinem Telefon die Pläne ausgehen, wo und wie ich zu Essen und Herberge komme. Und das geht bis zum Abend so, als ich völlig ausgelaugt nach Asturianos komme und die Herbergswirtin über ihre Brillenränder auf den Stempel der letzten Herberge starrt. „Madre mia, 42 km!“
Ich hätte sie nicht überlebt, gäbe es auf dem Weg nicht diesen kleinen Ort mit Namen Cernadilla, und in diesem Ort nicht die beiden Frauen, die ich auf dem Weg nach dem nächsten Café fragte. Kopfschütteln und ein Fingerzeig in die Runde: in allen Richtungen nichts zu finden, bis Asturianos keine Herberge, die geöffnet hat. Ob ich einen Kaffee wolle. Ja, sagte ich, das wäre wirklich freundlich. Daraufhin kam eine der beiden mit einem großen Con Leche aus dem Haus, einem Teller mit Gebäck und schließlich einem Sandwich mit Tortilla. Kinder fuhren mit ihren Rädchen auf der Dorfstraße herum, Katzen räkelten sich in der Sonne, und mein Tag war gerettet. Wir unterhielten uns eine Weile, bis ich weiter musste, um noch vor Dunkelwerden zur Herberge zu kommen. Ich kramte aus meinem Rucksack die Ladebank fürs Handy heraus und pries sie als brandneu an, und weil sie mir zu schwer sei und ich sie nicht wegwerfen wolle, würde ich sie gerne ihnen überlassen. Da wäre sie gut aufgehoben. Ich wüßte nicht, wie ich ihnen danken solle. Nein, sagte die Ältere, sie wollten nichts, als dass ich für sie in Santiago bete. Dann packten sie mir alles, was ich nicht gegessen hatte, in Alu und Plastik und wünschten mir einen Buen Camino.
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
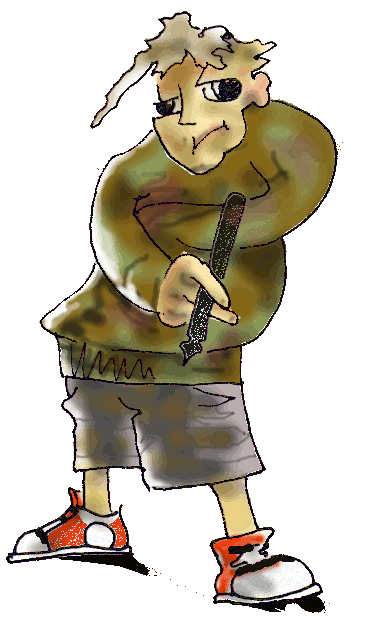
 Leider bleibt das so. Morgens in der spartanischen Unterkunft aufgewacht, mache ich mich gleich zu einem Frühstück auf. Der erste Ort, Olleros de Tera, ausgestorben, ich nehme den Umweg über Vega de Tera. Nach einer Stunde erreiche ich den kleinen Ort, ausgestorben. Sehe die Landstraße entlang und glaube, in der Ferne eine weitere Ortschaft auszumachen, in der es vielleicht Frühstück geben kann, ein Café, die rettende Bar. Mattigkeit holt mich ein, als ich den Ort selbst erreiche und dort wieder kein Café finde. Junquera de Tera liegt langgezogen an der Carretera N-525. Am Ende der Ortschaft parken Autos, Kommen und Gehen von Menschen zeigt mir vermeintlich an, dass ich dort suchen muss. Mittlerweile ist es nach neun und die Kilometer werden mir schwer.
Leider bleibt das so. Morgens in der spartanischen Unterkunft aufgewacht, mache ich mich gleich zu einem Frühstück auf. Der erste Ort, Olleros de Tera, ausgestorben, ich nehme den Umweg über Vega de Tera. Nach einer Stunde erreiche ich den kleinen Ort, ausgestorben. Sehe die Landstraße entlang und glaube, in der Ferne eine weitere Ortschaft auszumachen, in der es vielleicht Frühstück geben kann, ein Café, die rettende Bar. Mattigkeit holt mich ein, als ich den Ort selbst erreiche und dort wieder kein Café finde. Junquera de Tera liegt langgezogen an der Carretera N-525. Am Ende der Ortschaft parken Autos, Kommen und Gehen von Menschen zeigt mir vermeintlich an, dass ich dort suchen muss. Mittlerweile ist es nach neun und die Kilometer werden mir schwer.  Ich spüre, dass ich nicht gehe, vielmehr laufe. Endlich zum Frühstück. Es macht keinen Spaß, und ich muss mir Gedanken über mein Verhalten insgesamt machen. Ich fühle mich auf der Flucht, seit die Gruppe der Sportler aus Tábara mir im Nacken sitzt. Aber will ich meine Reise abhängig machen von einem Wettkampf? Rennt mir wegen meines Engagements als Reiseleiter im September die Zeit zur Vorbereitung davon? Kann ich mich von diesem Streß befreien, oder werde ich jetzt nach Santiago laufen wie ein Rennpferd? Wo ist die Entdeckerlust? Wo sind die ruhigen Stunden, in denen man in einer Dorfschänke seine Blasen pflegt? Gespräche? Die schöne, ruhige Zeit des Camino, wo ist sie hin?
Ich spüre, dass ich nicht gehe, vielmehr laufe. Endlich zum Frühstück. Es macht keinen Spaß, und ich muss mir Gedanken über mein Verhalten insgesamt machen. Ich fühle mich auf der Flucht, seit die Gruppe der Sportler aus Tábara mir im Nacken sitzt. Aber will ich meine Reise abhängig machen von einem Wettkampf? Rennt mir wegen meines Engagements als Reiseleiter im September die Zeit zur Vorbereitung davon? Kann ich mich von diesem Streß befreien, oder werde ich jetzt nach Santiago laufen wie ein Rennpferd? Wo ist die Entdeckerlust? Wo sind die ruhigen Stunden, in denen man in einer Dorfschänke seine Blasen pflegt? Gespräche? Die schöne, ruhige Zeit des Camino, wo ist sie hin?
 Die nächsten Ortschaften, die da kommen, sind eine wie die andere ausgestorben, haben keine Cafés und keine Bars und keine Herbergen. Jetzt begreife ich, weshalb man in Mombuey so wenig freundlich mit den Gästen umgehen kann. Es liegt an einem Stausee, der Ort ist voller Feriengäste, viele französische Klänge hört man auf der Straße, es ist schnelles Geld im Spiel und die Peregrinos, naja, nehmen vielleicht nur den Platz weg. Rundum Niemandsland, also kann man nicht anders als in Mombuey einkehren. Ich bin schon eine Stunde weg, als mir und meinem Telefon die Pläne ausgehen, wo und wie ich zu Essen und Herberge komme. Und das geht bis zum Abend so, als ich völlig ausgelaugt nach Asturianos komme und die Herbergswirtin über ihre Brillenränder auf den Stempel der letzten Herberge starrt. „Madre mia, 42 km!“
Die nächsten Ortschaften, die da kommen, sind eine wie die andere ausgestorben, haben keine Cafés und keine Bars und keine Herbergen. Jetzt begreife ich, weshalb man in Mombuey so wenig freundlich mit den Gästen umgehen kann. Es liegt an einem Stausee, der Ort ist voller Feriengäste, viele französische Klänge hört man auf der Straße, es ist schnelles Geld im Spiel und die Peregrinos, naja, nehmen vielleicht nur den Platz weg. Rundum Niemandsland, also kann man nicht anders als in Mombuey einkehren. Ich bin schon eine Stunde weg, als mir und meinem Telefon die Pläne ausgehen, wo und wie ich zu Essen und Herberge komme. Und das geht bis zum Abend so, als ich völlig ausgelaugt nach Asturianos komme und die Herbergswirtin über ihre Brillenränder auf den Stempel der letzten Herberge starrt. „Madre mia, 42 km!“