An der Grenze
Und so etwas gehört natürlich auch dazu: Eine Nacht im Schlafsaal mit einem Schnarcher, der bei allem Mitgefühl bald mal zum Arzt müsste. Am Morgen um halb sieben fangen die Radfahrer an, mit Stirnlampen bewaffnet, ihre Sachen zu packen. Man fühlt sich unter der Erde von Bergarbeitern umzingelt, die Erze abbauen. Um sieben Uhr habe ich mir meinen Rucksack geschnappt und das nächste geöffnete Café aufgesucht. Dort an der alten Landstraße zum Pass nach Galizien hinauf hinkt ein alter Mann hinter dem Tresen. Er stellt mir herrlichen Kaffee hin und Toast und versorgt mich mit Nachrichten über den Hirsch, der sonst immer um diese Zeit zu sehen sei, heute aber nicht. Das wird ein schöner Morgen, nur ziemlich frisch. Wir haben gerade mal zehn Grad, und die Sonne ist noch nicht über dem Hügel, als es weiter geht nach Padornelo. Ein paar Häuser am Pass, eine kleine Wirtschaft und ein Kaffee in der Sonne. Was will man mehr? Dann nach Lubián, ein kleines Bergdorf, in dem es von Touristen wimmelt. Die Pilgerherberge am Dorfrand steht leer mit dem Hinweis, dass die Tür offen sei. Drinnen der Aushang an der Wand: komme um 19:30 zum Stempeln.

Nun gut, der Ort könnte einladender sein, alle anderen Herbergen sind nämlich komplett, aber weiter zu gehen, birgt Risiken. Auf mindestens den nächsten 15 km werde ich sicher nicht unterkommen, möglicherweise geht das so bis La Gudiña, 23,5 km. Ich wäre weitere fünf Stunden auf den Beinen. Es sieht alles nach einer unfreiwilligen Pause aus. Meine Hose passt mir nicht mehr.
Drei Mal quer durch Lubián gegangen und verfallene Häuser fotografiert. An der Durchgangsstraße sind zwei Cafés. Im ersten habe ich mittags das Pilgermenü gegessen, viel zu viel. Jetzt war ich auch im zweiten. Dort saßen die jüngeren Einwohner und zockten Handygames. Fünf Männer an einem Tisch starren ins Handy und reden miteinander, als verfolgten sie vor dem Fernsehen ein Fußballspiel. Ab und zu wird eines der Fahrzeuge kommentiert, das auf der Straße entlang fährt, vor allem dann, wenn es viel Krach macht. Es geht um Schaltwagen und Automatik und Leistung und Unfälle und Kommentare darüber, wer von den Durchreisenden auf der Straße wie einparkt. Es kommen auch eine Menge Motorräder durch den Ort, die alte Passstraße neben der Autobahn muss ein Kurvenparadies für Zweiräder sein. Übermorgen haben sie hier im Ort den Fahrradtag. Da wird schon mächtig trainiert. Ein letzter Schlenker an der Kirche vorbei lässt mich auch den Supermarkt entdecken, ein Tante-Emma-Lädchen, in dem es nahezu alles gibt, das meiste wirkt, als stünde es seit zwanzig Jahren in den Regalen.

Zwei Dosen Bier, Haferkekse und isotonische Limonade, dann bin ich wieder draußen. Und diesmal fängt mich so richtig die Wehmut ein. Entweder bin ich meiner Zeit meilenweit voraus oder sowas von hinterher. In jedem Fall passe ich zumindest hier nicht ins Bild. Wäre ich wenigstens mit dem Bike gekommen und hätte auf der Durchgangsstraße einen Wheely probiert, aber ich bin einer, der mit dem Stock in der Hand den Berg runter kommt. Zu alt für die Zuschauer, zu jung für das, was ich tue. Ein Fremdkörper in einer Welt, die wohl momentan selbst nicht weiß, wo sie steht. Sieht aus, als wäre der vornehmliche Wunsch hier oben, abzuwandern.
Zum wiederholten Mal sitze ich also vor einer völlig leeren Herberge, rauche und trinke ein Dosenbier auf der Bank vor dem Haus. Ein Blick in den Spiegel sagte mir gerade, dass ich langsam auf mich aufpassen muss, denn mein Körper baut nun doch rapide ab. Man zwingt sich zum Essen, aber es reicht nicht. Es geht einfach nicht genug rein aber zu viel an Energie hinaus. Der Anblick eines Radrennsportlers nach der Tour de France bleibt im Hinterkopf haften. Eine Woche geht vielleicht noch, dann muss Erholung eintreten, sonst schädige ich mich unwiederbringlich.
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
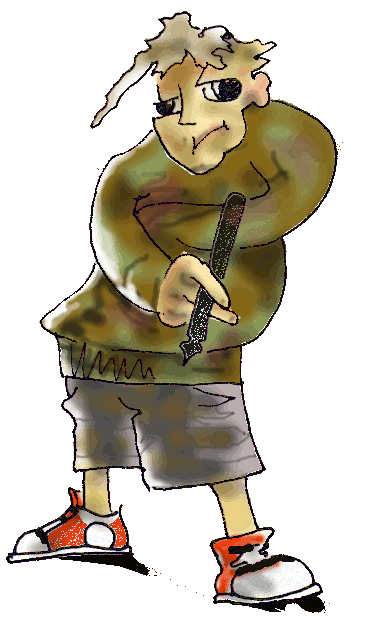
 Nun gut, der Ort könnte einladender sein, alle anderen Herbergen sind nämlich komplett, aber weiter zu gehen, birgt Risiken. Auf mindestens den nächsten 15 km werde ich sicher nicht unterkommen, möglicherweise geht das so bis La Gudiña, 23,5 km. Ich wäre weitere fünf Stunden auf den Beinen. Es sieht alles nach einer unfreiwilligen Pause aus. Meine Hose passt mir nicht mehr.
Nun gut, der Ort könnte einladender sein, alle anderen Herbergen sind nämlich komplett, aber weiter zu gehen, birgt Risiken. Auf mindestens den nächsten 15 km werde ich sicher nicht unterkommen, möglicherweise geht das so bis La Gudiña, 23,5 km. Ich wäre weitere fünf Stunden auf den Beinen. Es sieht alles nach einer unfreiwilligen Pause aus. Meine Hose passt mir nicht mehr.
 Zwei Dosen Bier, Haferkekse und isotonische Limonade, dann bin ich wieder draußen. Und diesmal fängt mich so richtig die Wehmut ein. Entweder bin ich meiner Zeit meilenweit voraus oder sowas von hinterher. In jedem Fall passe ich zumindest hier nicht ins Bild. Wäre ich wenigstens mit dem Bike gekommen und hätte auf der Durchgangsstraße einen Wheely probiert, aber ich bin einer, der mit dem Stock in der Hand den Berg runter kommt. Zu alt für die Zuschauer, zu jung für das, was ich tue. Ein Fremdkörper in einer Welt, die wohl momentan selbst nicht weiß, wo sie steht. Sieht aus, als wäre der vornehmliche Wunsch hier oben, abzuwandern.
Zwei Dosen Bier, Haferkekse und isotonische Limonade, dann bin ich wieder draußen. Und diesmal fängt mich so richtig die Wehmut ein. Entweder bin ich meiner Zeit meilenweit voraus oder sowas von hinterher. In jedem Fall passe ich zumindest hier nicht ins Bild. Wäre ich wenigstens mit dem Bike gekommen und hätte auf der Durchgangsstraße einen Wheely probiert, aber ich bin einer, der mit dem Stock in der Hand den Berg runter kommt. Zu alt für die Zuschauer, zu jung für das, was ich tue. Ein Fremdkörper in einer Welt, die wohl momentan selbst nicht weiß, wo sie steht. Sieht aus, als wäre der vornehmliche Wunsch hier oben, abzuwandern.