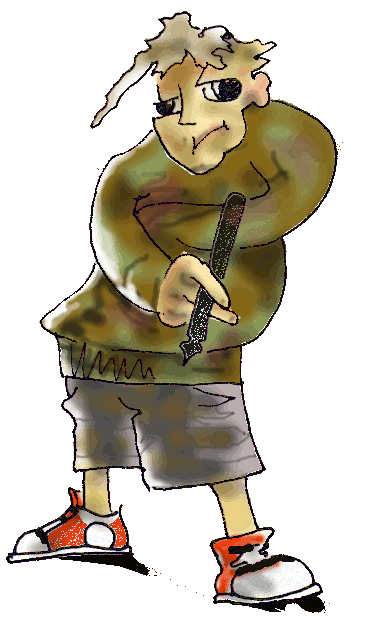Ist das eine Frage des Alters?
Ich nehme in letzter Zeit immer seltener ein gutes Buch zur Hand – und immer häufiger ein schlechtes. Nehme ich gute zur Hand, langweilen sie mich in der Regel. Und schließlich tritt mir, dem Leser, noch obendrein die Literaturkritik in den Hintern, eben weil das Werk mir unverständlich bleibt. Man müsse, um das feine Aroma dieses und jenes Werkes aufzunehmen, eben auch jenes und dieses kennen und überhaupt im Reigen der Kunst bewandert sein und dem kulturhistorischen Namedropping ganz ohne Regenmantel widerstehen.
So gesehen, indem man sich vom Kenntnisreichtum des wirklich Belesenen gnadenlos auspeitschen läßt. In jeder Zeile dessen, was man nicht versteht, soll ein Sinn vorgeführt werden, der auf der Hand läge, wäre man nur nicht so ungebildet, den ganzen Rest der künstlerischen Zirkelschlüsse nicht zu kennen oder sogar bis dato ignoriert zu haben. Weil, ja es einem schlichtweg nicht gefällt. Literatur ist nicht langweilig, weil sie langweilt, sie sei langweilig, weil der Leser ihr nicht gewachsen ist.
Nun, es ist schön, Literatur aus der Literatur zu begreifen und darin Wirklichkeit wieder zu finden wie ein Vogel, der aus einem Sammelsurium Nester baut, deren jedes Fragment nichts als ein Fundstück ist, alles zusammen eine Mulde bildet, in der sich brüten läßt, und schlussendlich wieder eine Warte, von der aus die Welt da unten betrachtet werden kann. Der Standpunkt eines höheren Wesens gebildeter Leser.
Aber ist das auch real? Meine erste Verlegerin nannte dieses Phänomen die Hermetizität von Literatur. Beide Phänomene. Denn wie der eine seinen Ulysses verehrt und alle Götter neben Joyce zu Götzen verdammt, indem er sie der Scharlatanerie überführt, ihre Stärken und Schwächen einzuordnen weiß, so wird der andere (Störe meine Kreise nicht) das Gesamtwerk von Agatha Christie als Fundament der Weltliteratur erkennen und sich in Handlungsorten und Verfilmungsvarianten ergehen, die man doch um Himmels Willen kennen muss. Und der Dritte ist im Universum des Jerry Cotton zu Haus.
Die Nationalökonomie der Literaturpatrioten verlangt nach einer starken Weltordnung, in der der Primat des edlen, allumfassenden und die Unterlegenheit des Trivialen gefordert ist, und so entbrennt der Krieg der Buchstaben um den Spiegel-Bestseller-Olymp, die staubigen Ledereinbände von Unibibliotheken, die 1.000 besten – Listen, das Muss-man-gelesen-haben-Kompendium. Und wer da nicht ganz und gar durchgebürstet ist, alle Bezüge weiß und nennen kann, wird sich bald so fühlen wie ich: ein Schwachmaat der Literaturwissenschaft.
Die sekundären Geschlechtsmerkmale der Literatur, also der sexy-Anteil der Sekundärliteratur, der uns die Zusammenhänge und die Großartigkeit der Werke an sich erklärt, hat was glamouröses, auch was anregendes an sich. Aber bei genauem Hinsehen erfinden sich diese Merkmale doch immer nur selbst. Sie verlieren den Bezug zu ihrem Objekt, indem sie den ungebildeten Leser verlieren. Nabelschau heißt dann das ganze und grämt sich um den Verlust der Weite. Die wieder soll im Ganzen gefunden werden. Das Einzelne ist wie der Halm im Vogelnest eben nur ein Faden, der sich durch einen (Flicken?)-Teppich zieht.
Ich lese gerade noch einen Lee Child und komplettiere mein durch Dick Francis' Banker gesätes Unverständnis zum Phänomen der Massentauglichkeit sehr spezieller Romane. Der Grund, warum diese Bücher ihr Publikum so zielstrebig finden, scheint der zu sein, dass sie sich nicht an die Kunsthistorie adressieren. Sie wollen unterhalten. Ein Rolls-Royce ist sicher ein tolles Auto, aber wenn man wissen will, wie ein Auto funktioniert, dann sollte man doch lieber einen Käfer zerlegen. So ähnlich wird das wohl auch mit dem Interesse an Literarischem sein. Nicht dass man deswegen Ulysses meiden sollte.
Aber ja, das schlechte Gewissen nagt dennoch. Denn man könnte ja jeden Abend 100 Seiten Literatur verschlingen, statt einfach nur Geschichten zu lesen ...
‰
 Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer
Aktuell
Bücher
Artikel
Biografie
Disclaimer